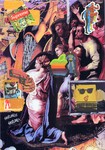Verklärung
In der digitalen Ära, in der Bilder in endlosen Strömen zirkulieren und Bedeutungen durch Kontextwechsel stetig transformiert werden, erhält die künstlerische Praxis der Collage eine neue Relevanz. Die hier präsentierten Collagen greife Fragmente aus Raffaels "Transfiguration" (1516–1520) auf. Ich habe sie und mit Elementen aus Popkultur, urbaner Bildsprache und zeitgenössischem Design zu einem pulsierenden, hybriden Bildraum montiert. Diese Werke stellen nicht nur eine ästhetische Kollision unterschiedlicher Zeiten, Stile und Ideologien dar, sondern laden auch zu einer kritischen Reflexion über Sakralität, Konsum, Körperpolitik und mediale Fragmentierung ein.
Raffaels "Transfiguration", sein letztes Werk, stellt ein zentrales Ereignis im Neuen Testament dar: die Verklärung Christi auf dem Berg Tabor. Im oberen Bildteil wird Christus in göttlicher Erscheinung gezeigt, im unteren Teil kämpfen seine Jünger damit, einen epileptischen Knaben zu heilen – eine Szene voller Dramatik, Pathos und menschlicher Verzweiflung.
Die in der Collage zitierten Figuren stammen aus diesem unteren Bereich: Zeigende, suchende und staunende Gesten werden extrahiert und aus ihrem theologischen Kontext herausgelöst. Was in Raffaels Gemälde Ausdruck einer metaphysischen Spannung ist, wird hier in einen säkularen, fragmentierten und visuell überreizten Raum überführt.
Die Collage operiert nicht mit einem kohärenten Raum, sondern mit visuellen Schichten.
Diese Bildsprache evoziert ein Gefühl der visuellen Überforderung, das emblematisch für die heutige digitale Kultur steht. Die ikonische Ordnung der Renaissance – geprägt von Komposition, Harmonie und metaphysischer Tiefe – wird durch ein polyphones, unübersichtliches Bildsystem ersetzt, das keine hierarchische Lesart mehr zulässt.
Jean Baudrillard beschrieb in seinem Konzept des Simulakrums ("Trugbild") eine Welt, in der die Differenz zwischen Original und Reproduktion verschwimmt – eine Welt, in der Zeichen nur noch auf andere Zeichen verweisen. Die Verwendung der "Transfiguration" in dieser Collage folgt genau diesem Prinzip: Das religiöse Originalbild wird zum ästhetischen Zitat, zur Hülle, zum Versatzstück in einem endlosen Strom von Bedeutungsüberlagerungen.
Die christliche Sakralität, die in Raffaels Werk durch Licht, Körperhaltung und Komposition vermittelt wird, erfährt hier eine Dekontextualisierung. Der „heilige Blick“ nach oben – ursprünglich auf den transfigurierten Christus gerichtet – führt in ein Bildfeld, das mit Konsumzeichen und Körperfragmenten gefüllt ist.
Die Collage ist ein paradigmatisches Ausdrucksmittel der Postmoderne: Sie negiert lineare Erzählungen, bevorzugt Fragmentierung, Ironie, Zitat und Hybridität. In der hier vorliegenden Arbeit erscheint die Collage zudem als Antwort auf die Bilderschwemme der Gegenwart: ein Versuch, Ordnung im Chaos zu schaffen.
Diese Collagen sind auch eine Reflexion über das Verhältnis von Vergangenheit und Gegenwart, von Spiritualität und Konsum, von Körper und Bild.